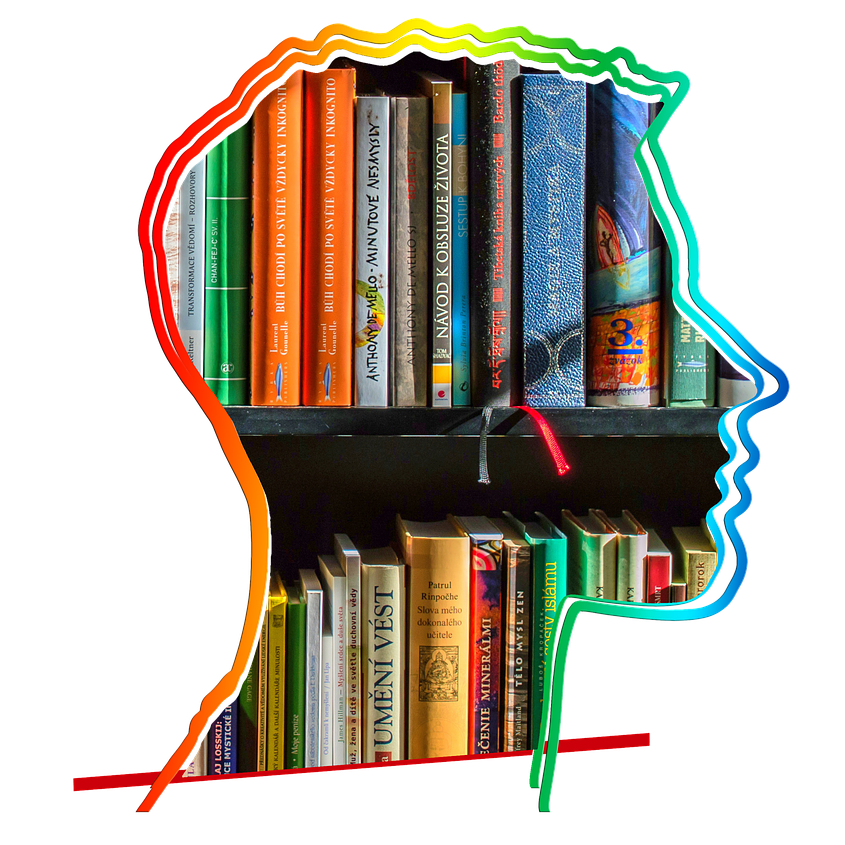“MOOCs sind akademische Kurse, welche einer großen Zahl von Interessierten (massive) frei zugänglich (open), online und zumeist kostenfrei angeboten werden” (Bischof & von Stuckrad, 2013, 6, Hervorhebung hinzugefügt).
MOOC ist ein Modell der Online-Lehre (Verlinkung), welches sowohl synchron (Verlinkung) als auch asynchron (Verlinkung) realisiert werden kann. Die steigende Beliebtheit von MOOCs lässt sich zurückführen auf die wachsenden Möglichkeiten der Digitalisierung (Verlinkung) und die sich dadurch ändernden Bedürfnisse der neuen internetaffinen Generation von Lernenden. Das MOOC-Konzept soll Bildungsbeteiligung verbreitern und demokratisieren, indem die Kursteilnahme von “Eingangsqualifikationen, formalem Studierendenstatus oder – von einem Computer mit Internetanschluss abgesehen – sonstigen sozioökonomischen Voraussetzungen” entkoppelt wird (Schulmeister, 2013, 231).
MOOCs werden auf Plattformen wie Iversity, Udacity, Coursera oder edX angeboten. Die Kurse können von den Erfinder:innen der Plattform, anderen Unternehmen oder Bildungsinstitutionen konzipiert sein. Nach dem erfolgreichen Besuch eines MOOCs kann ein Zertifikat über berufliche, Hochschul- oder Spezialisierungsqualifikation erlangt werden. Oft steht der Großteil der Lerninhalte zum kostenlosen Zugriff frei; eine Zahlung kann, je nach MOOC, für Teilnahme an benoteten Aufgaben, Prüfungen oder für die Ausstellung des Teilnahmezertifikats verlangt werden (vgl. Bischof & von Stuckrad, 2013, 45).
MOOCs lassen sich nach ihrer Struktur in zwei Kategorien einordnen: xMOOCs (die dominierende Form; ‘x’ steht für ‘Extension’, dt. Erweiterung) und cMOOCs (‘c’ steht für connectivist, dt. konnektionistisch). xMOOCs ähneln didaktisch der Fernlehre und machen u.a. vom Vorlesungsformat Gebrauch. In Abgrenzung zur Fernlehre lassen xMOOCs sich darüber definieren, dass sie nicht zwingend an eine Bildungsinstitution gebunden sein müssen, und somit auch keinen Anspruch auf studentische Betreuung wie Studienzentren oder Tutoren stellen (vgl. Schulmeister, 2013, 231).
cMOOCs hingegen ”nutzen […] die Möglichkeiten von Web 2.0 und den Sozialen Medien […] und setzen damit neue Formen des Lehrens und Lernens um” (Schulmeister, 2013, 201). cMOOCs basieren auf dem Prinzip des Lernens als selbstorganisierter Prozess in Netzwerken, bei dem die Lernenden eigenständig ihre Lernziele und -organisation bestimmen und die Inhalte des Kurses bewerten und mitproduzieren sollen (vgl. ebd., 163). Dies geht einen Schritt weiter als das konstruktivistische Prinzip (siehe Constructive Alignment (Verlinkung)): die Lernenden “werden zu gleichberechtigten Partner[:innen] beim gemeinsamen Lernen im Netzwerk, die Lehrenden werden zu ‘facilitators’ (dt. Vermittler, Moderatoren)” (ebd., 163). Leistungsnachweise in cMOOCs, abgesehen von einem Teilnahmezertifikat, erfolgen oft über Elemente des Game Based Learning (Verlinkung) wie Abzeichen (vgl. ebd., 198).
Die folgende Grafik fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen xMOOCs und cMOOCs zusammen:

Aus (medien)didaktischer (Verlinkung) Sicht bieten MOOCs, besonders cMOOCs, eine Plattform, um innovative didaktische Konzepte auszuprobieren (vgl. Schulmeister, 2013, 181). Trotz der höheren Kosten und Aufwand für Entwicklung von MOOCs besteht ihr Mehrwert unter anderem darin, dass MOOC-Materialien leicht wiederverwendet werden können, z.B. im Präsenzunterricht oder in einem Blended-Learning-(Verlinkung)Modell (vgl. Albó & Hernández-Leo, 2016, 578). Sie besitzen, wie andere digitale Lernformate, den Vorteil der zeitlichen und örtlichen Flexibilität, wodurch sich ein großes Potential für die Berufs- und Erwachsenenbildung offenbart. Dieses scheint bislang nicht genutzt zu werden: laut Befragungen sind MOOC-Teilnehmende überwiegend im Bildungsbereich Tätige, die sich weiterbilden möchten, und Freiberufler:innen (vgl. Schulmeister, 2013, 185).
Albó L. & Hernández-Leo D. (2016). Blended learning with MOOCs: towards supporting the learning process. Opportunities and impact of new modes of teaching. The Online, Open and Flexible Higher Education Conference. European Association of Distance Teaching Universities. p. 578-588.
Bischof, L. & von Stuckrad, T. (2013). Die digitale (R)evolution? Chancen und Risiken der Digitalisierung akademischer Lehre. CHE-Arbeitspapier Nr. 174
Schulmeister, R. (Hrsg.) (2013). MOOCs – Massive Open Online Courses – Offene Bildung oder Geschäftsmodell. (Dissertation, Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung der Universität Hamburg). Münster: Waxmann. Abgerufen von https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=51578 am 08.01.2023.
Bouchet, F. & Bachelet, R. (2019). Socializing on MOOCs: Comparing University and Self-enrolled Students. Lecture Notes in Computer Science, 31–36. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19875-6_4
Calise, M., Kloos, D. C., Reich, J., Ruiperez-Valiente, J. A. & Wirsing, M. (2019). Digital Education: At the MOOC Crossroads Where the Interests of Academia and Business Converge. 6th European MOOCs Stakeholders Summit. Lecture Notes in Computer Science, Band 11475) (1st ed.). Springer.
Gasevic, D., Kovanovic, V., Joksimovic, S. & Siemens, G. (2014). Where is Research on Massive Open Online Courses Headed? A Data Analysis of the MOOC Research Initiative. International Review of Research in Open and Distance Learning 115, pp. 134-176. doi.org/10.19173/irrodl.v15i5.1954.
Ress, L. (2013). Was ist ein MOOC? | Neue Lernwelten. Neue Lernwelten | Beratung, Konzept, Drehbuch für E-Learning-Lösungen. http://neue-lernwelten.de/was-ist-ein-mooc/
MOOCs – Hintergründe und Didaktik — e-teaching.org. (2021). https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/mooc