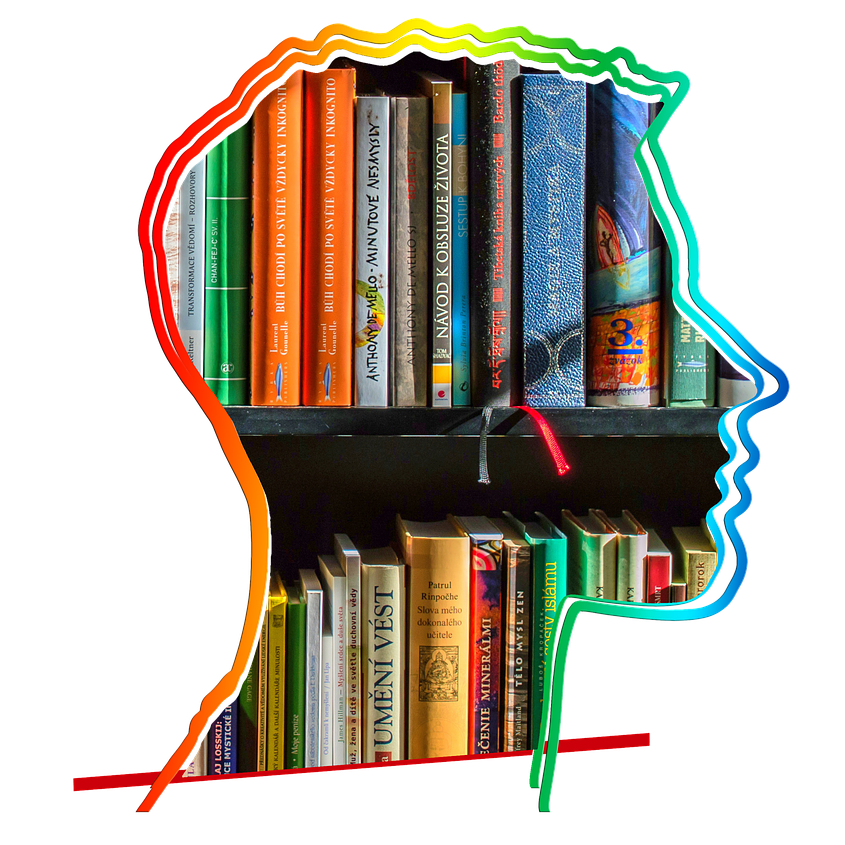Der Interessenbereich der Pflegewissenschaft stellt das Phänomen Pflege dar (vgl. Mayer, 2011, 26f.). Pflege umfasst einen zwischenmenschlichen Prozess u.a. durch Unterstützung und Begleitung von Menschen aller Altersgruppen, Durchführung präventiver, diagnostischer, therapeutischer, rehabilativer und palliativer Maßnahmen, Bratung, Anleitung, Schulung (Verlinkung) und Begleitung von Bürger:innen; Erhalt und Verbesserung der Pflege- und Selbstfähigkeit der Mitpflegenden sowie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Pflege und ihren Rahmenbedingungen (vgl. Brandenburg & Dorschner, 2021, 28).
Die berufliche Fachrichtung Pflege zeichnet sich durch ihre Komplexität hinsichtlich des pflegerischen Handelns auf unterschiedlichen Ebenen, in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Berufsgruppen sowie einer hohen Entwicklungsdynamik des Gesundheitswesens aus (vgl. KMK, 2019, 88). Die Ausbildung der Studienabsolvent:innen zielt auf die Befähigung dieser ab, Kenntnis grundlegender pflege- und bezugswissenschaftlicher Wissensbestände, pflegedidaktischer Theorien, Modele, Konzepte und Methoden in Bezug auf die Spezifika pflegerischen Handelns zu analysieren und zu reflektieren. Auf Basis dessen gilt es, die Bildungsanforderungen didaktisch und begründet für die Lern- und Lehrprozesse zu transformieren (vgl. ebd.) Entsprechend verknüpft ist ein umfassendes und vielfältiges Kompetenzprofil der beruflichen Fachrichtung Pflege. Studieninhalte erstrecken sich von Inhalten zur Pflegewissenschaft an sich, über gesundheitswissenschaftliche, medizinische und naturwissenschaftliche Grundlagen hin zu Grundlagen der Hygiene und der Medizinischen Mikrobiologie. Die Pflegedidaktik stellt ebenfalls einen Teil der Studieninhalte dar (vgl. ebd., 89f.). Kennzeichnend für den Studiengang Pflegewissenschaft als berufliche Fachrichtung ist laut Universität Osnabrück (o.J., o.S.) die Kombination aus Theorie und Praxis, sodass die neuen Herausforderungen bewältigt werden können. Zu diesen Herausforderungen gehören die zunehmende Zahl chronischer Krankheitsverläufe und die oftmals damit einhergehenden Mehrfacherkrankungen. Diese Problematik wird mit veränderten Anforderungen an qualifizierte pflegerische Leistungen in Verbindung gesetzt. In diesem Zusammenhang kann auch auf die Aussagen Kocks & Segemüllers (2018, 4) zurückgegriffen werden. Diese betonen die Tendenz der Professionalisierung der Pflege, was die bestehenden Herausforderungen noch einmal untermauert.
Brandenburg, H. & Dorschner, St. (2021). Pflegewissenschaft 1. Lehr- und Arbeitsbuch zur Einführung in wissenschaftliches Denken und Theorien in der Pflege. 4., überarbeitete und erweitere Auflage. Bern: Hogrefe Verlag.
Mayer, H. (2011). Pflegeforschung kennenlernen – Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung. 5. Auflage. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
Kocks, A. & Segmüller, T. (Hrsg.). (2019). Kollegiale Beratung im Pflegeteam. Implementieren – Durchführen – Qualität sichern. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
Universität Osnabrück (o.J.). Pflegewissenschaft – Lehramt an berufsbildenden Schulen. Abgerufen am 13.02.2023 von https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/pflegewissenschaft-lehramt-an-berufsbildenden-schulen/.
Schaeffer, D. & Wingenfeld, K. (Hrsg.) (2011). Handbuch Pflegewissenschaft. 2. Auflage. Weinheim, München: Juventa Verlag.